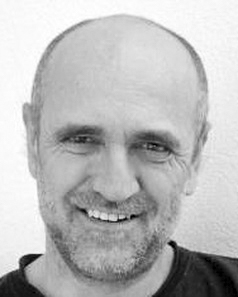Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser sagt, was Sache ist
Ich finde nicht oft Artikel im Internet, mit denen ich völlig übereinstimme. Heute ist es mir gelungen. Dem Artikel „Diakonie-Direktorin: „Unser Bildungssystem diskriminiert““ kann ich nur zustimmen. Der einzige „Fehler“, der da passiert ist, ist, dass der Bericht von der Pressekonferenz der Diakonie-Direktorin vom ORF der Kategorie „Religion“ zugeordnet worden ist. Der gehört aber ganz zentral und dick unterstrichen unter „Bildung“.
Ich könnte jetzt hergehen und passagenweise zitieren, was da Richtiges und Wichtiges steht – das wäre allenfalls als Kürzestzusammenfassung sinnvoll; mach ich: siehe unten.
Ein Vollzitat?
Ja, das wäre denkbar, wenn ich den ORF da nicht gegen mich aufbringe. Aber auf seiner news-Seite überlebt ja so ein Artikel allenfalls ein paar Tage; das wäre ein Grund, ihn hier direkt lesbar zu halten. Vor dem Vollzitat noch ein paar zentrale Sätze zur schnellen Orientierung:
- „Wir brauchen nicht andere Kinder, wir brauchen andere Schulen“
- mehr Ressourcen für den Ausbau inklusiver Bildung und mehr Einbezug der Eltern
- „Wir vermissen ein klares Bekenntnis zur inklusiven Bildung“
- „Bildungschancen werden vererbt und der soziale Status der Eltern hat nach wie vor einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder“
- Das Konzept der Deutschförderklassen habe versagt. In diesen fehlten den Kindern positive Sprachvorbilder, und sie entwickelten in anderen Schulfächern Lernrückstände
Ich erlaube mir noch eine kurze persönliche Ergänzung: wir brauchen im gesamten Pflichtschulbereich Schulen für alle Kinder in verschränkter Form: „Lernen, Üben, Erholung, Sport und Spiel wechseln einander ab“.
Und hier der Text über und rund um die Diakonie-Direktorin:
Diakonie-Direktorin: „Unser Bildungssystem diskriminiert“
[online seit Do 17.4., 13.37]
Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten und Kinder mit Behinderung werden im Bildungssystem diskriminiert, betonte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.
Bildung sei ein wichtiger Hebel für Integration, Inklusion und Aufstiegschancen, doch gerade jenen Kindern, die am meisten von ihr profitierten, bliebe Bildung vorenthalten. In aktuellen Bildungsdebatten entstehe der Eindruck, die Kinder seien das Problem. Das sei falsch.
„Wir brauchen nicht andere Kinder, wir brauchen andere Schulen“, erklärte Moser mit Nachdruck. Die Diakonie fordert daher eine flächendeckende Einführung eines „Chancenindex“ für sozial benachteiligte Schulstandorte, mehr Ressourcen für den Ausbau inklusiver Bildung und mehr Einbezug der Eltern.
Forderung nach inklusivem Unterricht
„Wir vermissen ein klares Bekenntnis zur inklusiven Bildung“, kritisierte Moser. Kinder mit Behinderung hätten nicht den gleichen Zugang zu Bildung wie Kinder ohne Behinderung. Frühkindliche Bildung sei für diese Kinder entscheidend, etliche von ihnen warteten aber auf einen Kindergartenplatz. Allein in Wien seien es 1.000 Kinder. Zum Hintergrund: Kinder mit Behinderungen sind vom verpflichtenden Kindergartenjahr befreit. „Eigentlich befreit sich damit der Staat von der Pflicht, geeignete Plätze zur Verfügung zu stellen“, so die Kritik der Diakonie.
Zusätzlich ende für Kinder mit Behinderungen das Recht auf Schulbildung mit der Schulpflicht. „Ein Rechtsanspruch auf ein 11. und 12. Schuljahr fehlt“, beklagte Moser. Sie begrüßte, dass der Rechtsanspruch im neuen Regierungsprogramm vorgesehen sei, jedoch brauche es eine rasche Umsetzung. Damit verbunden ist die Forderung der Diakonie, dass Ressourcen nicht für den Erhalt und den Ausbau des Sonderschulwesens eingesetzt werden sollen, sondern für inklusiven Unterricht.
Bildungschancen werden vererbt
Auch Kinder aus sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten und Kinder von Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss würden klar vom Bildungssystem benachteiligt werden. „Bildungschancen werden vererbt und der soziale Status der Eltern hat nach wie vor einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder“, sagte Moser.
Wie aus Studien hervorgehe, hätten nur 6 von 100 Kindern, die eine AHS oder BHS abschließen, Eltern mit lediglich einem Pflichtschulabschluss. Bereits in der vierten Schulstufe zeigten sich Lernrückstände von Kindern von Eltern mit einem niedrigen Schulabschluss von 21,7 Schulmonaten im Vergleich zu Kindern von Eltern mit Matura. Die Förderung ihrer Kinder bei einer Halbtagesschulordnung mit einem einkalkulierten Nachhilfesystem wäre für Eltern mit geringem Einkommen zudem nicht leistbar.
Negative Vorurteile
Hinzu kämen negative Vorurteile. „Die Forschung spricht hier von einem ‚stereotyp threat‘, also einer Bedrohung durch Beschämung“, führte Moser aus. Davon seien Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund besonders betroffen. „Wem nichts zugetraut wird, der oder die bringt schlechtere Leistungen“, so die Diakonie-Direktorin.
Zusätzlich verunsicherten Debatten um Abschiebungen die Kinder: „Mit Angst im Nacken können Kinder nicht gut lernen.“ Die Politik habe die Debatte auf Spracherwerb und Deutschförderung verengt. Das Konzept der Deutschförderklassen habe versagt. In diesen fehlten den Kindern positive Sprachvorbilder, und sie entwickelten in anderen Schulfächern Lernrückstände.
Chancenindex
Eine konkrete Forderung der Diakonie ist die flächendeckende Einführung eines Chancenbonus für sozial benachteiligte Schulen. Dazu notwendig sei die Verankerung im Finanzausgleich und der Ausbau ganztägiger, verschränkter Schulformen. „Mit einem solchen Sozialindex werden unter anderem Bildungsstand, Beruf und Einkommen der Eltern sowie die Alltagssprache der Schülerinnen erfasst“, hieß es in der Erklärung.
Je nach Ergebnis würde eine Schule um einen bestimmten Prozentsatz x mehr an Ressourcen bekommen. Diese müssten etwa in die Schulentwicklung, in die Unterrichtsqualität, in die räumliche Ausstattung der Schulen und in die sozialpädagogische Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer fließen.
Stärkere Einbeziehung von Eltern
Gefordert wird auch die stärkere Einbeziehung von Eltern. „Eltern wollen, dass ihre Kinder erfolgreich in der Schule sind, doch sie brauchen Unterstützung, damit sie ihre Kinder unterstützen können“, so Moser. Die im Regierungsprogramm vorgesehene Bildungspartnerschaft und Mitwirkungspflicht der Eltern weise in die richtige Richtung, doch mit Sanktionen und Druck zu arbeiten, sei „der falsche Weg“. Positive Unterstützung für Eltern seien etwa Elterncafes, Erziehungsberatung und Sozialarbeit, die die Eltern einbeziehen.
Solche Angebote liefert die Diakonie bereits etwa mit dem Projekt SESAM, das Bildungsveranstaltungen wie Medienworkshops oder Lese-und Vorleseworkshops in Volksschulen und Kindergärten in Wien und Niederösterreich anbietet. Zudem gibt es mehrsprachige Beratungsangebote mit Dolmetschern.
Ein Ziel sei es, „jenen Eltern, die nicht in Österreich zur Schule gegangen sind, Orientierung im österreichischen Schulsystem zu geben“, erklärte Projektleiterin Heike Summerer im Gespräch mit Kathpress. Da der Erfolg des Projekts von Förderungen abhinge, wünsche sie sich für die Zukunft, dass Elternbildung an Schulen fester Bestandteil des Bildungssystems werde.
Danke, Diakonie-Direktorin!